| Abendrot
Dämmerungserscheinung, bei der der Himmel rosa bis rötlich erscheint. Abends und morgens wird der Weg des Lichtes durch die Atmosphäre länger. Dabei wird derkurzwellige Anteil des Sonnenlichtes durch Staub- und Dunstteilchen immer weiter gefiltert, wodurch mehr langwellige, d.h. rote Farbanteile erhalten bleiben. |
| Abgleiten
Abwärts gerichtete Luftbewegung auf geneigten Gleit- oder Frontflächen in der Atmosphäre. Abwärts gerichtete Luftbewegungen sind nicht nur an geographischen Hindernissen möglich, sondern auch an Grenzflächen in der Luft |
| Abkühlung
Temperaturabnahme mit der Zeit. Abkühlung entsteht durch Wärmeausstrahlung, Abkühlung durch kältere Unterlagen, Volumenzunahme bei aufsteigender Luft und durch Heranführen und Mischen mit kühlerer Luft |
| Abkühlungsnebel
siehe Nebelarten. |
| Ablandiger Wind
Vom Land zum Wasser hin wehender Wind an grösseren Wasserflächen |
| Ablenkung
Abweichung des beobachteten Windes vom Gradientwind. |
| Absinken
Abwärts gerichtete Luftbewegung in der Atmosphäre. In Hochdruckgebieten, wo am Boden divergente, d.h.auseinanderströmende Luftströmung vorliegt, in der Höhe die Luft zusammenströmt, kommt es zu einem Absinken der Luft. Absinkende Luft ist i.a. mit Wolkenauflösung verbunden. |
| Absolute Feuchte
In Gramm pro Kubikmeter angegebenes Mass für den absoluten Wasserdampfgehalt im Luftvolumen. |
| Absoluter Nullpunkt
Aus den Gasgesetzen hergeleitete Temperatur, bei der die Bewegungsenergie der Gasmoleküle gleich Null ist.Das Gas ist somit festgefroren. |
| Absolute Temperatur
Kelvin-Temperaturskala, die den absoluten Nullpunkt als Fixpunkt hat. 0°C entspricht 273 K, die Abstände sind gleich den Celsiusunterschieden, also entspricht eine Temperatursteigerung um 1°C einer Temperatursteigerung um 1 Kelvin. Achtung: Es heißt Kelvin, nicht °Kelvin. |
| Absorptionskoeffizient
Ein für jeden Stoff typisches Maß für die durch ihn erfolgte Abschwächung/Absorption einfallender Strahlung. |
| Adiabatisch
Thermodynamische Vorgänge, die ohne Zufuhr oder Entzug von Wärme ablaufen. |
| Advektion
Horizontales Heranführen von Luftmassen. Die Advektion ergibt zusammen mit der Konvektion, der vertikalen Bewegung von Luftmassen, die Verlagerung von Luftmassen. |
| Advektionsnebel
Wenn feuchte Luft über eine kältere Unterlage geführt wird, sinkt ihre Temperatur, die Taupunktstemperatur wird unterschritten und Nebelbildung setzt ein. |
| Advektionswetterlage
Wetterlagen, bei denen ein großräumiger Austausch von verschiedenen Luftmassen stattfindet. Beispiel: Heranführen feuchtmilder Luft vom Atlantik nach Mitteleuropa im Sommer. |
| Aerologie
Wissenschaft, die sich mit der Erforschung der freien Atmosphäre befaßt. |
| Aerologischer Aufstieg
Aufsteigen einer Radiosonde zur Messung atmosphärischer Daten |
| Aerosol
Alle festen und flüssigen Fremdbestandteile, die sich in der Luft befinden. Beispiele: Staub, Chemische Stoffe, Salze, Vulkanasche. |
| Ageostrophischer Wind
Windkomponente, die die Abweichung vom geostrophischen Wind charakterisiert. Entweder eine Abweichung zum hohen oder zum tiefen Druck hin. |
| Aggregatzustand
Die von Druck und Temperatur abhängige entweder feste, flüssige oder gasförmige Erscheinungsform von Stoffen. |
| Agrarmeteorologie
Der Zweig der Meteorologie, der sich mit den Auswirkungen von Wetter und Klima auf die Landwirtschaft beschäftigt. |
| Aitken-Kerne
In der Luft vorhandene Schwebeteilchen. Wichtig sind die Aitken-Kerne v.a. wegen ihrer Eigenschaften als Kondensationskerne und ihrer Bedeutung für die Streuung und Absorption von Strahlung. |
| Aktionometer
Meteorologisches Meßgerät zur Bestimmung der Intensität der solaren Strahlung. |
| Aktive Kaltfront
siehe Kaltfront. |
| Aktives Aufgleiten
Aufgleiten von warmer Luft auf vorhandene Kaltluft, z.B.an einer Warmfront. Gegensatz zu passivem Aufgleiten,wobei sich Kaltluft unter Warmluft schiebt. |
| Albedo
Das Verhältnis zwischen reflektierter und einfallender solarer Strahlung. Je höher die Albedo, desto besser ist das Reflektionsvermögen des jeweiligen Mediums. Einige Beispiele: Schnee 0,7 bis 0,8, Wasserflächen ca. 0,1, Erdboden 0,1 bis 0,4. |
| Alkoholthermometer
siehe Thermometer. |
| Allgemeine Meteorologie
Wissenschaft, die sich mit der Beschreibung und Erklärung meteorologischer Phänomene und Zusammenhänge beschäftigt. Teilgebiet der Meteorologie. |
| Alpenglühen
Bei Dämmerung vorherrschender Vorgang, bei dem sich v.a. rote Farbtöne der untergehenden Sonne auf Felsen nd Schnee- und Eisflächen spiegeln. Spezielle Form des Morgen- und Abendrots. |
| Alpine Meteorologie
Teilgebiet der Meteorologie, das sich mit Wetter und Witterung im Hochgebirge beschäftigt. |
| Alterung
Der Verlust ursprünglicher Eigenschaften von Luftmassen, z.B. durch dynamische Vorgänge und Bewegung vom Ursprungsgebiet weg. Beispiel: Maritime Luft, die sich über Landmassen geschoben hat und ihren Charakter durch Feuchte- oder Temperaturveränderungen mit der Zeit verliert. |
| Altocumulus
Weiße und/oder graue Flecken, felder oder Schichten von Wolken, im allgemeinen mit Eigenschatten aus schuppenartigen Teilen, Ballen, walzen usw. bestehend, die manchmal teilweise faserig oder diffus aussehen und zusammengewachsen sein können. Die meisten der regelmäßig angeordneten kleinen Wolkenteile haben gewöhnlich eine scheinbare Breite von 1 Grad (kleiner Finger) bid 5 Grad (3 finger breit bei ausgestrecktem Arm). Mischwolke, d.h. aus Wassertropfen und teilweise aus Eiskristallen bestehende Wolkenform, die in 2000 und 7000 m Höhe auftritt. altocumulus (lat.) = von altum - Höhe und cumulus |
| Altostratus
Graue oder bläuliche Wolkenfelder oder -schichten von streifigem, faserigem oder einförmigem Aussehen, die den Himmel ganz oder teilweise bedecken und stellenweise gerade so dünn sind, dass die Sonne wenigstens schwach wie durch Mattglas zu erkennen ist. Bei Altostratus treten keine Halos auf. Sie gehören zu den mittelhohen Wolken zwischen 2000 und 7000 Metern. altostratus (lat.) = von altum und stratus |
| Altweibersommer
Lang anhaltende Schönwetterperiode zwischen September und Oktober. Dafür sorgt ein blockierendes Hochdruckgebiet über Mitteleuropa, das Tiefdruckgebiete nach Süden oder Norden ablenkt und damit längere Zeit für fast sommerliches Wetter sorgt. |
| Amboß
Das für Cumulonimbuswolken typische, amboßartige Aussehen |
| Anabatischer Wind
Wind mit aufwärts gerichteter Bewegungskomponente |
| Anafront
Front, bei der sich Warmluft aktiv über Kaltluft schiebt. Gegenteil: Katafront. |
| Anemometer
Allgemeine Bezeichnung für alle Arten von Windmessern. |
| Aneroidbarometer
Dosenbarometer, bei dem der Luftdruck auf eine sogenannte Vidiedose wirkt. Die dadurch entstehende Deformation der Dose kann mittels geeigneter Anzeigen direkt abgelesen werden. Der Vorteil des Aneroidbarometers liegt darin, daß keine Korrekturterme für Stationshöhe oder Temperatur benötigt werden. |
| Anomalie des Wassers
Die Tatsache, daß Wasser nicht an seinem Gefrierpunkt, sondern bei +4°C die größte Dichte hat. |
| Anthropogene Klimabeeinflussung
Durch den Menschen hervorgerufene Beeinflussungen des Klimas. |
| Antizyklonale Bewegung
Auf der Nordhalbkugel im Uhrzeigersinn erfolgende Drehung. Hochdruckgebiet |
| Antizyklone
Hochdruckgebiet, bei dem auf der Nordhalbkugel die Drehung im Uhrzeigersinn erfolgt |
| Aprilwetter
Wetterlage mit schnellem Wechsel zwischen sonnigen Abschnitten, dichter Bewölkung und Schauern, also extrem unbeständiges Wetter. |
| Äquatoriale Tiefdruckrinne
Gebiet des mittleren tiefen Drucks um den Äquator herum |
| Äquatorialluft
Warmfeuchte Luftmasse mit Ursprungsgebiet um den Äquator. |
| Äquipotentialfläche
Fläche, auf der das Potential konstante Werte hat. |
| Äquivalenttemperatur
Ist die Temperatur, die ein Luftvolumen annimmt, wenn der gesamte in der Luft enthaltene Wasserdampf zur Kondensation gebracht wird und die freigesetzte Energie zur Erwärmung der Luft dient. |
| Arcus
Eine dichte, horizontale Walze mit mehr oder weniger zerfetzten Rändern, dia am unteren teil der Vorderseite bestimmter Wolken auftritt, Sie hat bei großer Ausdehnung das Aussehen eines dunkel-drohenden Bogens. Diese Sonderform tritt bei Cumulunimbus und - weniger häufig - bei Cumulus auf. arcus (lat.) = von arcus - Biegung, Bogen, Bogengang, Gewölbe |
| Arid
Von arid = trocken abgeleitete Bezeichnung für Gebiete, in denen die Verdunstung größer ist als die Menge erhaltenen Niederschlags. Daher auch der Name des amerikanischen Bundesstaates "Arizona" für "aride Zone". |
| Arktikfront
Arktische Frontalzone, die die arktische Zirkulationszelle von der polaren Zelle trennt. Hierbei handelt es sich nicht um eine ständig vorhandene Frontalzone. |
| Arktikluft
Luftmasse mit Ursprungsgebiet Arktis. |
| Arktischer Seerauch
siehe Seerauch. |
| Aspirations-Psychrometer
Aus zwei Thermometern und einem Ventilator bestehendes Gerät zur Messung der relativen Luftfeuchte. Ein durch einen Strumpf feuchtgehaltenes Thermometer zeigt eine geringere Temperatur als ein trockenes Thermometer an, da durch die Verdunstung des Wassers Wärme entzogen wird. DieTemperaturdifferenz ergibt die relative Luftfeuchte. Zur Beschleunigung der Verdunstung wird das Feuchthermometer mit einem Ventilator einem Luftstrom ausgesetzt. |
| Atmosphäre
Die einen Planeten umgebende Gashülle. |
| Atmosphärische
Gegenstrahlung
Die von der Atmosphäre reflektierte, langwellige terrestrische Strahlung. Die Luft der Erde absorbiert die terrestrische Strahlung und gibt sie nach Umwandlung in Wärme grösstenteils wieder an die Erdoberfläche ab. |
| Atmosphärische Grenzschicht
Die unterste Schicht der Atmosphäre, in der ungeordnete, turbulente Luftbewegungen vorherrschen. Die charakteristische Dicke beträgt ab dem Erdboden bis zu 1000 m. |
| Aufbau der Atmosphäre
Die Atmosphäre ist allgemein in 4 Schichten unterteilt. Die Troposphäre, in der die Temperatur mit der Höhe abnimmt, reicht vom Erdboden bis in 7 bis 11 km Höhe. Die Tropopause trennt die Troposphäre von der darüber liegenden Stratosphäre, in der die Temperatur mit der Höhe fast unveränderlich ist. Über der Stratopause schließt sich die Mesopause an, in der die Temperatur zuerst mit der Höhe ab-, dann wieder zunimmt. Oberhalb der Mesopause, d.h. ab ca. 120 km Höhe, liegt die Thermosphäre, in der die Temperatur bis auf +2000°C ansteigt, und die keine klare Obergrenze hat. |
| Auffrischen
Windzunahme bei gegebenen schwachwindigen Wetterlagen. Bei stärkeren Winden wird bei einer weiteren Windzunahme nicht mehr von Auffrischen gesprochen. |
| Aufgleitbewölkung
Durch Aufgleitvorgänge an Frontflächen und geographischen Hindernissen hervorgerufene Bewölkung. Steigt Luft auf, so kühlt sie sich ab und der in ihr enthaltene Wasserdampf kondensiert, es enstehen Wolken. |
| Aufgleiten
Aufwärts gerichete Luftbewegung an geneigten Frontflächen. |
| Aufgleitfläche
Geneigte Frontfläche, die wärmere Luft in der Höhe von kühlerer Luft unten trennt. |
| Aufheiterung
Vorgang, bei dem dichte Bewölkung Lücken bekommt. |
| Auflandiger Wind
Gegenteil von ablandigem Wind. Der Wind weht vom Wasser zum Land hin (Seewind). |
| Auge
Innerster Teil eines Wirbelsturms, in dem weitgehend Windstille herrscht. |
| Auslösetemperatur
Diejenige Temperatur, die ein Luftpaket erreichen muss, um bis in sein Kondensationsniveau aufzusteigen. Das Erreichen der Auslösetemperatur erfolgt meist durch Aufheizung durch Sonnenstrahlung, ab Erreichen der Auslösetemperatur setzt dann Quellwolkenbildung ein. |
| Ausstrahlung
Abgabe von Wärme vom Erdboden und Luftschichten in Form langwelliger Strahlung an den Weltraum oder an obere Luftschichten. |
| Austausch
Alle turbulenten Vorgänge, bei denen Luftschichten durchmischt werden. Bei austauscharmen Wetterlagen findet eine Durchmischung von Luftschichten kaum statt. Beispiel: Inversionen, bei denen kaum eine Durchmischung mit "frischer" Luft stattfindet. (Schadstoffwerte nehmen zu) |
| Austauscharme Wetterlage
Von einer austauscharmen Wetterlage spricht man, wenn großräumig nur geringe Luftdruckunterschiede herrschen, also wenig Luftbewegung und Luftaustausch stattfindet. |
| Autan
Pyrenäenföhn. Warmer und trockener Fallwind aus Süd bis Südost in Südfrankreich. |
| Azorenhoch
Ein stabiles Hochdruckgebiet als Teil des subtropischen Hochdruckgürtels. Das Azorenhoch, das fast immer mehr oder minder existiert, ist auch in Mitteleuropa wetterwirksam, da sich immer wieder Hochdruckzellen aus ihm lösen und über Mitteleuropa ziehen. |
| Alle veröffentlichten Daten
sind Eigentum der jeweiligen Stationen des
Verbandes deutschsprachiger Amateurmeteorologen und dürfen nur zum privaten Gebrauch heruntergeladen werden.Bei Fragen bitte an den Webmaster wenden. Letzte Aktualisierung 06.04.2002 ã regional-wetter.de |
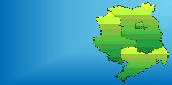 |