| Fahrenheit
Temperatureinheit. Als Fixpunkt 0°F (Grad Fahrenheit) dient die von D. Fahrenheit kälteste gemessene Temperatur einer Mischung aus Wasser, Eis und Salmiak von -17,8°C. Der zweite Fixpunkt 100°F entspricht der menschlichen Körpertemperatur von 37,8°C. Eine Temperaturänderung um 1°F entspricht also einer Änderung von 0,56°C oder 0,56 K. |
| Fahrt-Wellen-Diagramm
Diagramm, das den Zusammenhang zwischen Wellenhöhe, dem Einfallswinkel der Welle und derSchiffsgeschwindigkeit darstellt. |
| Fahrtwind
Gegenwind bei Bewegung. Zur Ermittelung des wahren Windes auf Schiffen aus der Schiffsgeschwindigkeit abzuleitende Windgeschwindigkeit. Aus Fahrtwind und scheinbarem Wind kann man den wahren Wind in einem Winddreieck auftragen. |
| Fallböe
Häufig als Luftloch bezeichneter abwärts gerichteter Vertikalwind, v.a. im Lee von geographischen Hindernissen. |
| Fallgeschwindigkeit
Die Geschwindigkeit, mit der Niederschlags- und Wolkenteilchen Richtung Erdboden fallen. Sie ist abhängig von Form, Gewicht und Größe der Teilchen und bewegt sich von 1 cm/s bei Wolkentröpfchen und bis zu 30 m/s bei Hagelkörnern. |
| Fallout
Radioaktiver Niederschlag, der sich auf dem Boden ablagert. In der Atmosphäre befindliche radioaktive Partikel werden nicht als Fallout bezeichnet. |
| Fallwind
Im Lee von Gebirgen auftretende, abwärts gerichtete Luftbewegung. Einige wirken sich regional so stark aus, daß sie eigenen Namen erhalten haben, wie z.B. Föhn, Chinook und Bora. |
| Fata Morgana
Luftspiegelung, bei der weit entfernte Gegenstände scheinbar in der Nähe des Beobachters auftauchen. Sie entstehen dadurch, daß die bodennahe Luft stark aufgeheizt wird und an der Grenzfläche zu der kühleren Luft oben das Licht komplett reflektiert wird. |
| Fehlprognose
Nicht realer Vorgang, bei dem Meteorologen angeblich nicht zutreffende Vorhersagen machen. Fehlprognosen sind angeblich sehr häufig zu beobachten. Tatsache ist jedoch, daß sie in der Natur fast nie anzutreffen sind. |
| Fernerkundung
Sammeln von Daten über entfernte Objekte, ohne mit diesen in Kontakt zu kommen. Wichtigstes Beispiel sind Satelliten. |
| Ferngewitter
In so großer Entfernung vom Beobachter stattfindendes Gewitter, daß nur das Wetterleuchten zu beobachten ist, akustische Erscheinungen (Donner) jedoch nicht bemerkbar sind. |
| Fernsicht
Meteorologische Bezeichnung für Sichtweiten größer als 50 km. Allgemein spricht man auch je nach Trübung der Luft von guter und schlechter Fernsicht. |
| Ferrel-Zelle
Zelle der mittleren Breiten. Im "Bjerknes Modell der Atmosphäre" werden die Erdhalbkugeln in je drei Zirkulationszellen unterteilt. Eine am Äquator, die "Hadley Zelle", eine Zelle der mittleren Breiten, die "Ferrel-Zelle", und eine Polarzelle. Die Zellen sind durch die Subtropen- und die Polarfront voneinander getrennt. In der Ferrel-Zelle findet nach dieser Theorie der Wärmetransport aus der Äquatorregion zu den Polgebieten hin statt. |
| Festeis
Im Gegensatz zu lockerem Eisbrei ist Festeis charakterisiert durch eine geschlossene Form. Beispiel: Eisschollen. |
| Festlandluft
Kontinental geprägte Luftmasse mit wenig Feuchte. Gegensatz: Meeresluft. |
| Fetch
Windwirklänge. Diejenige Strecke, die dem Wind über Wasser zur Verfügung steht, um Seegang hervorzurufen. |
| Feuchtadiabate
Linie, die den Zusammenhang zwischen Druckänderung und Änderung der Temperatur eines mit Wasserdampf gesättigten Luftpakets anzeigt, dem weder Wärme entzogen noch zugeführt wird. siehe Thermodynamisches Diagramm. |
| Feuchtadiabatisch
Bezeichnung für Prozesse, bei denen mit Wasserdampf gesättigte Luftpakete Druckänderungen unterworfen sind, z.B. bei Aufsteigen oder Absinken. |
| Feuchtadiabatischer
Temperaturgradient
Abnahme der Temperatur bei Aufstieg oder Absinken eines mit Wasserdampf gesättigten Luftpakets. Er beträgt allgemein zwischen 0,4 und 0,6°C pro 100 m, bei sehr tiefen Temperaturen nähert er sich immer weiter dem trockenadiabatischen Temperaturgradienten an, da kalte Luft weniger Wasserdampf enthalten kann als wärmere Luft. |
| Feuchte
Wasser- oder Wasserdampfgehalt der Luft, aber auch anderer Stoffe, bes. Gase. |
| Feuchtindifferent
Bestimmte Art der Schichtung der Luft. Von feuchtindifferent geschichteter Luft spricht man, wenn die Temperaturabnahme dem feuchtadiabatischen Temperaturgradienten entspricht. |
| Feuchtlabil
Von feuchtlabil geschichteter Luft spricht man, wenn die Temperaturabnahme mit der Höhe größer ist als der feuchtadiabatische Temperaturgradient. Ein Luftquantum, das feuchtadiabatisch aufsteigt, würde also weiter steigen, da seine Temperatur immer höher wäre als die der Umgebungsluft. |
| Feuchtstabil
Von feuchtstabil geschichteter Luft spricht man, wenn die Temperaturabnahme mit der Höhe kleiner ist als der feuchtadiabatische Temperaturgradient. Ein feuchtadiabatisch aufsteigendes Luftpaket käme also in ein Gebiet höherer Temperatur und würde nicht weiter aufsteigen. |
| Feuchtthermometer
Thermometer, dessen Meßfühler feucht gehalten wird. Durch die entzogene Verdunstungswärme mißt ein Feuchtthermometer eine niedrigere Temperatur als ein Trockenthermometer. siehe Psychrometer. |
| Fibratus
Vereinzelte Wolken oder ein dünner Wolkenschleier, die aus fast gradlinig oder auch mehr oder weniger unregelmäßig gekrümmten Fasern bestehen, die jedoch nicht Haken- oder büschelförmig enden. fibratus (lat.) = von fibratus - faserig, mit Fasern oder Fäden versehen |
| Firn
In die Jahre gekommener Altschnee, der von der Oberfläche her angetaut und wieder gefroren ist. |
| Fixpunkt
Festgehaltene und jederzeit nachvollziehbare Orientierungspunkte, u.a. zur Temperaturbestimmung. siehe Celsius, Fahrenheit. |
| Flaute
Windstille |
| Flautenfront
Vorübergehendes Abflauen des Windes, das gelegentlich nach Durchzug einer Kaltfront auftritt. |
| Flächenblitz
An der Wolkenuntergrenze auftretende Spiegelung eines Blitzes, sodaß die gesamte Wolkenuntergrenze "leuchtet". |
| Floccus
Eine Wolkenart, bei der jede Einzelwolke wie ein kleiner cumulus-förmiger Bausch aussieht, dessen unterer Teil mehr oder weniger ausgefranst ist, wobei häfig Virga-Bildung auftritt. Diese Bezeichnung wird bei Cirrus, Cirrocumulus und Altocumulus angewendet. floccus (lat.) = von floccus - Wollbüschel, Flocke oder Noppe eines Tuches |
| Flügelradanemometer
Windmesser, ähnlich bunten Kinderwindrädern oder den Windrädern zum Wasserpumpenbetrieb. Meteorologisch ist es kaum in Gebrauch, hier werden v.a. Schalenkreuzanemometer verwendet. |
| Flugwetterkunde
Auch Flugmeteorologie. Teilgebiet der meteorologie, das sich mit den Auswirkungen des Wetters auf die Luftfahrt befaßt. siehe Meteorologie. |
| Flüssigkeitsbarometer
Die Mutter aller Druckmeßgeräte. Dabei wird die Wirkung des Luftdrucks auf eine in einem Röhrchen befindliche Flüssigkeit ausgenutzt. Mit Änderung des Luftdrucks ändert sich die Höhe der Flüssigkeitssäule, das Ergebnis kann man direkt ablesen, muß allerdings noch Korrekturfaktoren beachten, die von der jeweiligen Temperatur abhängen. |
| Flüssigkeitsthermometer
Die Mutter aller Thermometer. Mit Änderung der Temperatur ändert sich auch das Volumen von Flüssigkeiten. Diese Volumenausdehnung kann man in einem Glasröhrchen direkt ablesen. Je nach Temperaturbereich wählt man verschiedene Flüssigkeiten. |
| Flußeis
In Fließgewässern auftretendes Ei |
| Flußrauch
siehe Seerauch. |
| Föhn
Ursprünglich warmer, trockener Fallwind auf der Alpennordseite. Inzwischen wird dieser Effekt auch in anderen Gebirgen als Föhn bezeichnet, wenn er dort keinen eigenen Namen hat, z.B. in deutschen Mittelgebirgen. |
| Föhnfische
Bei Föhn häufig zu beobachtende Lenticularis-Wolken mit linsenförmigem Aussehen, die parallel zum Gebirgskamm angeordnet sind und ihre Lage nur wenig verändern. |
| Föhnmauer
Bei Föhnwetterlagen über dem Kamm auftetende Wolkenbank, die durch den Stau auf der Luv-Seite des Gebirges entsteht. |
| Fournier-Regel
Faustregel zur Bestimmung der Zugbahn eines tropischen Wirbelsturms. |
| Fractus
Wolken in Form unregelmäßiger Fetzen von deutlich zerrissenem Aussehen. Diese Bezeichnung wird nur bei Stratus und Cumulus angewendet. fractus (lat.) = von fractus - zweites Partizip des Verbums frangere = zerschmettern, brechen, zerknacken, zerbrechen |
| Freie Atmosphäre
Die gesamte Lufthülle der Erde ab einer Höhe von ca. 1000 m. Die darunter liegende atmosphärische Grenzschicht ist im Gegensatz zur freien Atmosphäre noch Reibungseffekten des Erdbodens ausgesetzt. |
| Freier Föhn
Außerhalb von Gebirgsregionen auftretendes, föhnähnliches Absinken der Luft. Allgemeine Bezeichnung für abgleitende Luft. |
| Front
Grenzbereich zwischen Luftmassen unterschiedlichen Charakters. Je nach Bewegungsrichtung bezeichnet man die Front als - Warmfront, wenn warme Luft gegen kühlere Luft geführt wird, - als Kaltfront, wenn kalte Luft gegen wärmere geführt wird, als Okklusion oder Mischfront, wenn Warm- und Kaltfront zusammenfallen. Fronten sind keine klar abgegrenzten Flächen, sondern sie stellen einen Übergangsbereich mit nicht geringer Dicke dar, sollten also eher als Übergangszone verstanden werden. |
| Frontenneigung
Winkel zwischen dem Erdboden und der Frontfläche. Kaltfronten sind steiler geneigt als Warmfronten. |
| Frontensystem
Zu einem Tiefdruckgebiet gehörende Warm- und Kaltfront, bei alternden Tiefdruckgebieten auch noch mit einer Okklusion, da wo Warm- und Kaltfront zusammenfallen. |
| Frontalnebel
Vor Warmfronten auftretender, meist schmales Nebelgebiet. |
| Frontgewitter
Gewitter, bei dem die notwendige Hebung der Luft durch Aufgleiten an Kaltfronten entsteht. Im Winter ist das Frontgewitter fast die einzig mögliche Gewitterform, es kommt meist zu einer ausgedehnten Gewitterlinie. |
| Frontogenese
Entstehung einer Frontalzone durch Aufeinandertreffen von verschiedenen Luftmassen. |
| Frontolyse
Auflösung und Zerfall einer Front, wenn sich die Gegensätze zwischen den getrennten Luftmassen verringern. |
| Frost
Von Frost spricht man bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt des Wassers, d.h. bei 0°C, 32°F oder 273 K. |
| Frostgraupel
Dem Hagel ähnliche Niederschlagsform, bei dem sich unterkühlte Wassertröpfchen an Eisteilchen anlagern und bei genügendem Gewicht und Größe zur Erde fällt. |
| Frostklima
Teil der Klimaeinteilung, der die Bereiche bezeichnet, in denen die Mitteltemperatur ganzjährig unter dem Gefrierpunkt liegt. Nur Polargebiete. |
| Frostschutz
Alle Mittel zur Vermeidung von Frostschäden, auch probater Süßstoff für verschiedene Weine. |
| F-Schicht
In zwei Schichten unterteilte Schicht der Atmosphäre ab einer Höhe von 140 km über der Erdoberfläche. siehe Aufbau der Atmosphäre. |
| Fujiwhara-Effekt
Vorgang, der die gegenseitige Beeinflußung zweier Wirbelstürme beschreibt. Befinden sich zwei Wirbelstürme in relativer Nähe zueinander, dann kreisen sie um den gemeinsamen Schwerpunkt, der sich verlagert. Die Kombination dieser Bewegungen ergibt die Zugbahnen der Wirbel. |
| Fühlbare Wärme
Die Meteorologie unterscheidet zwischen zwei Arten von Wärme. Die erste ist die sogenannte fühlbare Wärme, die mit einem Thermometer gemessen werden kann. Die zweite ist die sogenannte latente Wärme, d.h. die im Wasserdampf enthaltenen Energie, die zum Verdampfen des flüssigen Wassers benötigt wurde. |
| Fühltemperatur
Die Fühltemperatur, auch Windchilltemperatur (eng.) genannt, beschreibt die Temperatur, die man an der Hautoberfläche wahrnimmt. Sie wird beeinflußt von der wahren Lufttemperatur, dem Wind und der Luftfeuchte, wobei es auch Formeln ohne die Luftfeuchte gibt. Macht man den Versuch, bei windigem Wetter den befeuchteten Finger in die Luft zu halten, wird man feststellen, dass sich dieser kühler anfühlt, als die anderen. Diesen Temperaturunterschied nennt man auch "psychrometrische Differenz" oder Auskühlung durch Verdunstung. Die Formel lautet: 33+(t-33)*(0,478+0,237*(WURZEL(ff*3,6)-0,0124*ff*3,6) t - Lufttemperatur in Grad celsius, ff - Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde Bei 5 °C und 7 m/s (25,2 km/h) beträgt die gefühlte Temperatur minus 11,7 °C. |
| Alle veröffentlichten Daten
sind Eigentum der jeweiligen Stationen des
Verbandes deutschsprachiger Amateurmeteorologen und dürfen nur zum privaten Gebrauch heruntergeladen werden.Bei Fragen bitte an den Webmaster wenden. Letzte Aktualisierung 06.04.2002 ã regional-wetter.de |
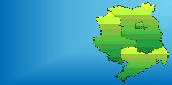 |